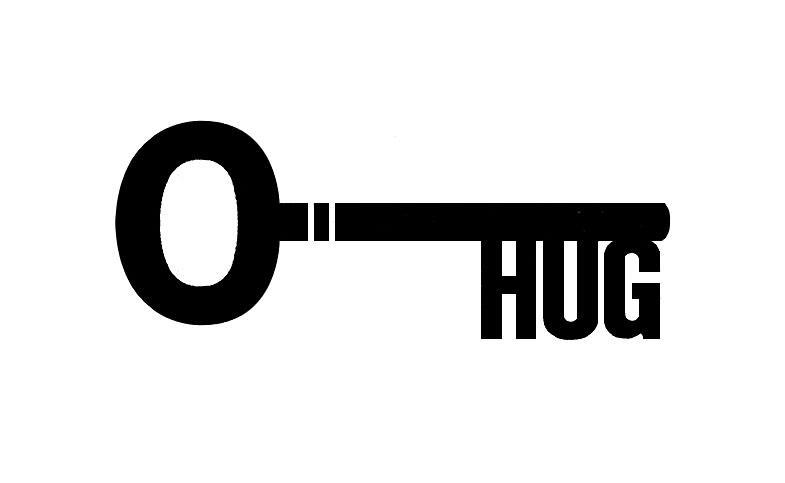Was macht einer mit so viel Talent
Text von Res Brändle
Theater, Film, Performances und Installationen im künstlerischen Schaffen von Giuseppe Reichmuth
Nichts weiter als eine Reihe glücklicher Umstände soll es gewesen sein, was den dreissigjährigen Giuseppe Reichmuth in den Aargau und damit zum Theater führte. Er hatte eine Frau aus Baden kennen gelernt, in ihrer Wohngemeinschaft war ein Zimmer frei geworden, zu dem hatte sich die Gelegenheit ergeben, mit dem Künstler Marco Squarise den still gelegten Verkaufsladen des Konsumvereins beim Kloster Wettingen als Atelier zu mieten. "Konsulenten für seltsame Abenteuer" nannten die beiden sich keck im Gespräch mit dem "Badener Tagblatt" vom 8. Februar 1975. Das neue Umfeld schien grad richtig für eine Doppelexistenz, wie sie dem jungen Grafiker Reichmuth vorschwebte. Aus Zürich brachte er genügend Beziehungen zu Werbeagenturen mit, um sich mit gut bezahlten Aufträgen den Lebensunterhalt zu finanzieren und darüber hinaus sich Freiräume leisten zu können: viel Zeit zum Malen. Er brauchte Abstand. Marco Squarise kam aus einer Künstlerfamilie, die kleinstädtische Umgebung schuf Distanz zum Vermarktungsgewerbe und bot überdies vielerlei Anregungen, ein bemerkenswert reichhaltiges Kulturleben für damalige Begriffe. Jugendliche hatten die Fassade des Badener Bahnhofs poppig bemalt, ein farbenfrohes Bild, das in der ganzen Schweiz beachtet wurde. Nebenan zeigte Peter Sterk, noch vor den grossen Häusern in Zürich und Basel, in seinem Kino die neuesten Filme, verfolgte das Schaffen französischer Cineasten und Geheimtipps wie Roman Polanski. Nach den Vorführungen sass man bis tief in die Nacht in der "Promenade", einer Beiz an der Limmat, verabredete sich zu den nächsten Veranstaltungen, besuchte die Jazzkonzerte in der Kantonsschulaula, Ausstellungen im Trudelhaus, den Folkclub im Jugendhaus, Kabaretts und Improvisationen in den zahlreichen Kellern der Altstadt, nahm Anteil am politischen Theater der Claque, die mit ihrem Programm ebenso wie dem basisdemokratischen Arbeits modell die Kritiker der überregionalen Zeitungen verblüffte.
Auf einem seiner frühesten Werke hat Giuseppe Reichmuth die städtebaulichen Wahrzeichen Badens in tropischen Urwald versetzt. Das Bild wurde prämiert, mittels Kunstkredit erworben und über den Arbeitstisch des Stadtschreibers gehängt. Für kurze Zeit gab es so gut wie keine Berührungsängste. Das "Badener Tagblatt" beschäftigte freiberufliche Linksintellektuelle, für künstlerische Experimente fanden sich immer wieder Gönner aus der Bürgerschaft, liberal gesinnte Geschäftsleute wie der Malermeister Max Käufeler oder der Apotheker Edi Zehnder. Sie gaben Geld, machten Gratisarbeit, aus lauter Freude, dass in Baden so viel los war. Und weil man sich in einer Kleinstadt gegenseitig braucht, dauerte es nicht lange, bis Giuseppe Reichmuth von der Claque gebeten wurde, das Bühnenbild für die Inszenierung von Julie Schraders "Genoveva oder die weisse Hirschkuh" zu gestalten. Zu diesem surreal-inbrünstigen Text aus den 1920er-Jahren verspürte Reichmuth eine starke Affinität. Er setzte die wieder entdeckte Autorin als Mumie auf die Bühne, mit Häubchen und weisser Schürze wie ein Dienstmädchen gekleidet, in ihrer Brust kleine Lautsprecher montiert. Daraus waren, von einer Frau aus dem Altersheim mit brüchiger Stimme gelesen, die Regieanweisungen der Julie Schrader zu hören, so wunderbar komisch: "Zuerst ist eine schöne Musik von Orchestro. Es kann 'Die Post vom Walde' sein, aber auch 'Heut' ist der Tag des Herrn'. Alles muss schön ruhig sein, nicht rascheln! Wie in der Oper. Wenn die Musik dahin ist, ist auch der Vorhang dasselbe. (...) Vevchen kniet vorn an der Brüstung und jeder im Saal kann ihre Tränen und ihre schöne Tallje an sich sehen." Und nach allerlei Verwirrungen treibt alles dem Happy End entgegen, das Vevchen und der Edelkurt "sinken sich in die Arme und kommen sehr schön auf Kuss. Der Vorhang kommt nicht so schnell, dass man von dem Kuss auch was hat. Schöne Musik!"
Über ein Jahr lang hielt die Produktion sich im Repertoire, sie ging auf Tournee und wurde am Schweizer Fernsehen gezeigt.
In einer Art Kontrastprogramm war Giuseppe Reichmuth später noch einmal in der Claque zu Gast, als Schauspieler diesmal, am Heiligabend 1979 in "Familie Meili", einer Weihnachtsfeier für den Bekanntenkreis und ein paar Vereinsamte, Alkoholiker, Homeless aus dem weiteren Einzugsgebiet. Diese mischten sich bald lautstark in die Vorstellung ein. Sie waren es gewohnt, den Christabend in wohlig-sentimentaler Beizenatmosphäre zu verbringen oder von karitativen Organisationen verköstigt zu werden. Jetzt fühlten sie sich verarscht. Fast wäre es zu einer Schlägerei gekommen.
Schon die erste Begegnung mit dem Theater wurde für Giuseppe Reichmuth zu einem Schlüsselerlebnis: "Bei der Claque gab es Einheitslöhne von monatlich 1600 Franken, sehr wenig also, und dabei haben sich alle mit so viel Engagement und Herzblut ins Zeug gelegt, dass ich mir sagte: 'Wenn die das schaffen, müsste es mir ebenfalls gelingen, als ein freier Künstler zu leben.'" Eine seiner letzten Arbeiten für die Werbebranche wurde zu einem eigentlichen Gemälde. Ein etwa zehnjähriges Mädchen steht im Badeanzug auf dem Sprungbrett, darüber weitet sich schier endlos ein flockiger Himmel. Das Original übrigens hängt bis heute im Hauptgeschäft des Auftraggebers, der Patria Versicherung in Basel.
So leicht freilich, wie im Rückblick dargestellt, dürfte Giuseppe Reichmuth der Entscheid zum Künstlerleben nicht gefallen sein. Er war in ganz anderen Verhältnissen aufgewachsen, zusammen mit drei jüngeren Schwestern in Affoltern am Albis. Der Vater war Buchhalter, führte ein Treuhandbüro mit dörflicher Kundschaft; das waren Handwerker, Kleingewerbler wie er selber. Die Mutter, eine Seconda italienischer Abstammung, führte den Haushalt und half im Geschäft mit, wenn die Jahresabschlüsse oder sonstige Terminkollisionen es erforderten. Eine patente Frau, sie war es auch, die sofort aktiv wurde, als aus dem sanktgallischen Gossau ein freundlicher Brief eintraf. Geschrieben hatte ihn Pater Landolt, einer der Lehrer am katholischen Internat Friedberg. Er unterrichtete Mathematik und Zeichnen und teilte den Eltern Reichmuth mit, dass ihr Filius nicht länger mit lateinischen Vokabeln gequält werden sollte, zumal er mit seinen Talenten an einer Kunstschule viel besser aufgehoben wäre. Also packte die Mutter all die sperrigen Sachen zusammen, die der kleine Giuseppe während Jahren gebastelt hatte - ganze Häuser aus Karton und Pavatex, richtig gehende Architekturmodelle -, und fuhr damit zum Vorstellungsgespräch nach Zürich. Er selber, erzählt Giuseppe Reichmuth, habe stumm daneben gesessen, als Professor Fischli, der Direktor der Kunstgewerbeschule, sich die kindlichen Arbeiten vorführen liess. Viel Zeit habe der Professor sich genommen, alles sehr lange angeschaut und dann zur Mutter gesagt, sie brauche sich um ihren Sohn keine Sorgen zu machen, er werde in den Vorkurs der Kunstgewerbeschule aufgenommen.
Erst später habe er erfahren, sagt Reichmuth, dass es für die zwanzig Studienplätze im Vorkurs rund fünfhundert Bewerbungen gegeben habe und was für ein Privileg es war, ein ganzes Jahr lang die eigenen Vorlieben und Fähigkeiten ausprobieren zu können, in vielseitigem Unterricht, von Zeichnen über Schriftenlehre und Modellieren bis zur Fotografie, um sich dann in einer Fachrichtung zu spezialisieren. Und wieder sei es wie von selbst zu einer Entscheidung gekommen. Das grafische Gewerbe boomte, überall Hochkonjunktur, Atelierleiter kamen persönlich an die Kunstgewerbeschule, um begabte Leute aus dem Vorkurs als Lehrlinge anzuwerben. Giuseppe hatte bereits die Aufnahmeprüfung für den Grafikerlehrgang an der Kunstgewerbeschule bestanden, als Beny Olonetzky ihm eine Lehrstelle anbot. Das sei ein angesehener Berufsmann, wurde ihm allseits versichert und auch geraten, die Chance zu nutzen, weil eine praxisnahe Ausbildung dem schulinternen Curriculum vorzuziehen sei.
Vier Jahre dauerte die Grafikerlehre an der Carmenstrasse in Zürich. Beny Olonetzky beschäftigte fünf Angestellte, zu seinem Betrieb gehörte ein kleines Fotostudio. Den Lehrlingen lieh er an den Wochenenden seine Kameras aus und liess sie nach Belieben das Labor benutzen; auch für das Fotopapier mussten sie nichts bezahlen. Während der Arbeitszeit stellte er gerne kleine Spezialaufgaben, um ihnen beizubringen, wie man Kompositionen aufbaut, Schriften einsetzt und mit Leerräumen umgeht. Neben solchen Trockenübungen wurden sie auch mit externen Aufträgen betraut. Für die Firma Schlüssel Hug kreierte Giuseppe als Lehrling sein erstes Signet, das nach mehr als vierzig Jahren heute noch in Gebrauch ist.
Den Lehrabschluss schaffte er mit glänzenden Noten. An der Diplomfeier sei ihm dies eher genierlich gewesen angesichts einiger Kollegen, die extra schlechte Arbeiten abgegeben hatten, um nicht als Musterschüler dazustehen. Nicht nur er, sagt Giuseppe Reichmuth, habe eine solche Haltung damals bewundert.
Ein paar Monate arbeitete er bei Olonetzky weiter, dann fuhr er nach Paris. Mindestens ein Jahr wollte er bleiben. Der Anstoss kam von Oscar Schnider, einem befreundeten Grafiker. Auch er hatte die Zürcher Kunstgewerbeschule besucht und sich nach der Ausbildung sofort ins Ausland aufgemacht, fürs Erste als Hilfspfleger in einem Pariser Spital gearbeitet und unweit der Champs-Élysées einen kleinen Raum gefunden, passend für ein gemeinsames Werbebüro. Giuseppe war sofort begeistert. Schweizer Grafiker zählten zur Weltklasse damals, von diesem Renommee würde man sicher profitieren. Weil aber die beiden Jungunternehmer sich mit ihrem Schulfranzösisch doch etwas unsicher fühlten, suchten sie sich einen Pariser Kompagnon, der Aufträge akquirieren und mithelfen sollte, ihre Arbeiten mit der nötigen Eloquenz zu präsentieren.
Gut sechs Monate dauerte das Experiment. Dann zog Oscar Schnider nach New York weiter, der französische Kollege ging seiner eigenen Wege, allein konnte Giuseppe Reichmuth das Büro nicht weiterführen. Da er es jedoch als Niederlage empfunden hätte, früher als geplant in die Schweiz heimzufahren, bewarb er sich, in den Fussstapfen von Freund Osci sozusagen, um eine Aushilfsstelle am Hôpital Saint-Michel und wurde in der Krebsstation engagiert.
Nach der Rückkehr fand er, dreiundzwanzigjährig, in Zürich sofort wieder beruflich den Anschluss, fuhr bald ein schnittiges Auto, arbeitete für verschiedene Werbeagenturen, Wiener & Deville, die international tätige Lintas-Kette und die kleine Agentur von Marco Fedier, als Freelancer meistens, manchmal auch im festen Angestelltenverhältnis, doch nie länger als ein halbes Jahr. Dieser Rhythmus habe sich aufgedrängt, um möglichen Beförderungen auszuweichen und damit der Gefahr, in eine Werberkarriere hineinkatapultiert zu werden, kommentiert Reichmuth seine fetten Jahre.
An Einzelheiten mag er sich nicht erinnern. Zahllose Logos, das Übliche eben, viel Kleinkram und dazwischen immer mal wieder eine Kampagne. Da arbeitete man ein paar Tage und Nächte auf Hochdruck, um potenziellen Kunden eine Vorstellung davon zu geben, wie ihre Produkte am besten zu vermarkten wären. Drei Vorschläge hatte man zu präsentieren, eine freche Version, eine konventionelle Variante und einen Kompromiss. Fast ausnahmslos entschieden die Auftraggeber sich fürs Bravste. Dass Werbung sich selber ironisieren könnte, wie Giuseppe Reichmuth dies am liebsten praktizierte, war damals noch nicht verständlich. Freches hatte "gerissen" zu sein, "fetzig", "peppig", "flippig"; sogar "augenzwinkernd" galt schon als sehr gewagt.
Was Wunder, dass Giuseppe Reichmuth die Humorlosigkeit zu schaffen machte. Und seine zunehmende Frustration hatte wohl auch mit den Unruhen von 1968 zu tun. Auch wenn er an den Zürcher Krawallen nicht beteiligt war, sei ihm, wie er sagt, doch ein Licht aufgegangen. Imponierend, wie radikal alles hinterfragt wurde: Manipulation, Verführung zum Überflüssigen, die Rolle der Werbung innerhalb einer gigantischen Wirtschaftsmaschinerie, so manches gab es auch in seiner Branche in Frage zu stellen, und das war das Schlimmste: Selbst in der eigenen Arbeit drehte alles sich einzig ums Geld.
Damals trug er sich mit dem Gedanken, eine Filmschule zu besuchen. Weil Roman Polanski, sein Lieblingsregisseur, in Lodz studiert hatte, liess er sich Studienunterlagen aus Polen schicken und machte sich daran, berufsbegleitend die Matura nachzuholen, denn ohne einen Mittelschulabschluss, hiess es, würde er niemals an eine Filmschule aufgenommen.
Dann zerschlugen die Pläne sich wieder. Giuseppe Reichmuth hatte Näherliegendes vorgezogen, war in Baden gelandet. Eine Zwischenlösung hätte es sein sollen, um Zeit und Distanz zu gewinnen, doch war er in neue Aufgaben hineingerutscht und deshalb ein paar Jahre länger im Aargau geblieben. Von Baden zog er ins benachbarte Oberehrendingen hinauf, ein kleines Dorf hinter den Lägern, um an der Gipsstrasse eine Hausgemeinschaft mitzugründen.
Bald nach dem Bühnenbild für die Claque kam die Anfrage, ein Zirkusplakat zu malen. Werner Meier, ein Badener, hatte in Paris die Mimenschule von Jacques Leqoc besucht, zusammen mit Richard Hirzel aus St. Gallen. Seither sind die beiden Pic und Pello. Sie haben sich einen Namen geschaffen auch mit ihren Vorstellungen von einem Zirkus, der an speziellen Schauplätzen ortsansässige Artisten mit begeisterungsfähigen Laien zusammenbringen und so die ganze Umgebung mit einbeziehen möchte. Schon mit dem ersten Projekt war es ihnen gelungen, das St. Galler Publikum von der Stimmigkeit eines kleinen Platzes in der Altstadt dermassen zu entzücken, dass daraufhin die geplante Schnellstrasse mitten durchs Klosterquartier am Widerstand der Bevölkerung scheiterte. Später gelang es, wieder mit einem Freiluftzirkus, die Privatisierung der Dreiweiher oberhalb der Stadt zu verhindern. Nach etlichen Jahren dankten die Behörden für das Engagement, indem sie den ersten Zirkusstandort beim Kloster offiziell in Pic-o-Pello-Platz umtauften.
Nun sollte auch Baden sein Circus Variété erhalten, 1976 im sommerlichen Kurpark, nicht gegen etwas diesmal, sondern als ein Gemeinsinn stiftendes Ereignis. So liessen es die beiden Clowns verlauten und baten um zahlreiches Mitwirken. Gegen zweihundert Personen boten Beiträge an, kleine Kunststücke, Einfälle aller Art ebenso wie gute Dienste im Hintergrund. Nicht aufzuzählen, was sich gleichsam aus dem Nichts an brauchbaren Nummern anzusammeln begann. Steff Lichtensteiger, Mittelschüler (und später Schauspieler), platzte wortlos ins Casting hinein, schlug mit zwei Löffeln einen minutenlangen Wirbel auf ein Holztaburettli. Auch der junge Palino plante als Reprisenclown sein künstlerisches Coming-out. Heidi Winter bewarb sich mit einer Arie aus der "Zauberflöte" und willigte ein, auch noch "Mein süsses Pony" zu singen, weil die kleine Tochter des Italienischlehrers Antonio Ritter nicht abzubringen war von der Idee, einen ausgewachsenen Schimmel in der Manege herumzuführen. Fürs Orchester meldeten sich dreissig Personen, darunter auffallend viele Junglehrer, die Jazzschulen besuchten. Als Kapellmeister liess sich Ruedi Häusermann aus Lenzburg verpflichten, auch er noch in Ausbildung am Zürcher Konservatorium. Giuseppe Reichmuth hatte die ganze Werbung übernommen und nebenbei den Wunsch geäussert, als Taucher über die Köpfe der Zuschauer zu fliegen, mit angewinkelten Armen, die wie Flossen wirken würden. Also erfand man die passende Hängevorrichtung, so kam Giuseppe zu seinem Überflug, im Kurpark von Baden, und sein Zirkusplakat soll nicht als Rückfall ins Werbemetier verstanden werden. Es gehörte zur Gebrauchsgrafik, wie er sie nie ganz aufgegeben hat. Jedes Jahr macht er Weinetiketten für seinen Schwager im Tessin, gestaltete hin und wieder Plattenhüllen und CD-Covers von befreundeten Musikern, ein Poster für das Kindertheater von Matto und Pello (das dann zum Bühnendekor vergrössert wurde) und malerische Aushänge für Zürcher Kulturanlässe wie Theater Spektakel und Jazz Festival; letztere Arbeit wurde aus 2000 Einsendungen als eines der "Schweizer Plakate des Jahres 1983" prämiert.
Für die meisten war das Zirkusengagement ein einmaliges Erlebnis, für andere überdies eine Art von Durchlauferhitzer. Bei den Vorbereitungen war man sich näher gekommen. Bekanntschaften wurden aufgefrischt, Erfahrungen ausgetauscht, Freundschaften geschlossen. Neue Konstellationen begannen sich herauszubilden, und so ist wohl zu erklären, dass sieben Monate nach Pic-o-Pello ein nächstes Ereignis in Baden überregional von sich reden machte: Das Jerry Dental Kollekdoof mit "Gornergrat - das rockende Inferno".
Da habe sich eins aus dem andern ergeben, erklärt Christoph Baumann. Er war die treibende Kraft, dreiundzwanzigjährig, an der Jazzschule Bern. Zuvor hatte er das Lehrerseminar Wettingen besucht und dort in Schülerbands mitgespielt. Daraus entstand Dr. Eisele's Rock'n' Roll Stomperband, mit einer abendfüllenden Show, halb Imagination, halb Parodie - eigener? -, jugendlicher Idole wie Elvis Presley, Frank Zappa, Toni Vescoli, eine lustvolle Auseinandersetzung jedenfalls mit musikalischen Erfolgsphänomenen von Drafi Deutscher bis "Jesus Christ Superstar". Das war etwas Neues, ein Anfang war somit gemacht und die Richtung viel versprechend. Als geschlossene Formation traten die Stomperbander dem neuen Kollekdoof bei, und aus dem Pic-o-Pello hatte Christoph Baumann zusätzliche Leute mitgebracht, Persönlichkeiten mit andern musikalischen Hintergründen und aus visuellen Kunstrichtungen: den Maler Andy Wildi, den Bildhauer Theo Huser und Giuseppe Reichmuth, der sich bestens ins "Rockende Inferno" einbringen konnte. Zusammen mit Baumann, Wildi und Mark Graf arbeitete er am Konzept, zeichnete mitverantwortlich für die Bühnenausstattung, malte das Plakat, übernahm etliche Nebenrollen und den hinreissenden Part der alten Dame, einer Grossmutter im Lehnstuhl, die mit ihrer Stricknadel den Pfadfinder ersticht.
Vergeblich sucht man nach einer adäquaten Beschreibung. Die Fernsehaufzeichnungen sind unauffindbar. "Eine geballte Ladung Kreativität", "Show total" ist in den Rezensionen nachzulesen, "musikalische Unterwanderung", "Fruchtsalat für Aug' und Ohr", "schaurig schön" und "unsäglich komisch". Ja, man müsse das gesehen haben, schwärmen die Besucher der ersten Stunde, und man glaubt ihnen gern. Obwohl anderes vielleicht noch mehr zu staunen gäbe, wenn man heute die Besetzungslisten anschaut: Wie viele mittlerweile bekannte Jazzer im Kollekdoof mitwirkten! Und dass sie fast alle aus derselben Gegend stammen, Urs Blöchlinger, Hämi Hämmerli, Ruedi Häusermann, Robert Morgenthaler, Marco Käppeli, Peter Schärli, Christoph Baumann. Vom Aargau aus weitere Kreise zogen, in wechselnden Formationen, die über kurz oder lang die meisten zum Theater führten und in verschiedener Weise auch immer wieder ins Schaffen von Giuseppe Reichmuth hineinspielten.
Er selber war bereits im "Rockenden Inferno" zum Kern des Kollekdoofs vorgestossen, eine verlässliche Kraft, auch als man sich Gedanken über eine Fortsetzung des erfolgreichen Erstlings zu machen begann, in der erklärten Absicht, sich nicht selbst zu kopieren. Trotz ähnlich lautendem Titel sollte "Das kochende Inferno" die gewachsenen Ansprüche einlösen, will heissen, noch stärker aufs Optische achten und die internen musikalischen Differenzen zu einem tragenden Spannungselement weitertreiben, diese auch dramaturgisch entschiedener nutzen, als Störfaktor, wie zum Beispiel Ruedi Häusermanns Ländlerkapelle, die sich von ihrer kleinen Alternativbühne aus mehr und mehr Gehör verschaffen sollte.
Eine Geschichte für sich, dass auch die Frauen im Kollekdoof sich stärker bemerkbar machten. Bisher hatten sie im Chor gesungen und nebenher selbstverständlich Kostüme geschneidert. "Das kochende Inferno" erst führt im Programmheft die Kostüm verantwortlichen auf, Brigitte Märki (inzwischen bei Flamenco en route), Susi Füeg, Pjotr Frei, Andy Wildi, Barbara Maier (seither Kostümbildnerin an verschiedenen Theatern) und zwei weitere Barbaras, Barbara Baumann und Barbara Reichmuth (was auch etwas über den familiären Charakter des Kollekdoofs aussagt).
Giuseppe spielte den Kinderstar Maria Armfeig und führte Regie. Oder schaute von aussen zu, wie er sagt, denn alle machten ohnehin, was sie wollten. Obwohl sie eigentlich wussten, was sie zu tun hatten: Die einzelnen Rollen waren festgelegt, die Noten geschrieben, die Abläufe besprochen worden während langer Vorbereitung in der Konzeptgruppe. Auch erste Bilder waren dabei entstanden, nach dem Skizzenbuch von Giuseppe Reichmuth. Hier findet sich auch das legendäre Tableau von der üppigen Tafel, die das ganze Ensemble versammelt.
Die meisten kamen direkt von der Arbeit, wenn abends die Proben begannen. Sie dauerten zwei bis drei Stunden in der Regel, um zehn Uhr wurde zusammengepackt, man ging gemeinsam in die Beiz. Anschliessend setzte Giuseppe Reichmuth sich ins Hallenbad ab und malte noch ein paar Stunden an seinem Wandbild weiter, seinem ersten öffentlichen Auftrag. Anderntags machte er weiter, pinselte Meter für Meter ein pastellenes Meer auf die Betonwand, ging abends ins Kollekdoof. Natürlich sei das verflucht anstrengend gewesen und jetzt mit zweiundsechzig Jahren leicht zu sagen, dass er solche Situationen auch gesucht habe. Weil er die Extreme liebe, abrupte Wechsel und wohl immer beides brauchen werde, das Theater, den Betrieb, unterwegs sein mit andern und dann wieder Ruhe, Tür zu, auf sich allein gestellt als Maler vor einer neuen Arbeit im Atelier. Es mache ihm nichts aus, manchmal wochenlang mit niemandem zu reden, nur in den letzten Jahren, sagt er, sei er zu viel allein gewesen, es müsse wieder etwas passieren.
Theaterhäuser für freie Produktionen gab es zu Kollekdoof-Zeiten noch keine. Man brachte die eigene Ausrüstung in Alternativbetriebe mit. "Das kochende Inferno" spielte in einer Wirtschaft mit offener Küche, Premiere war im Rössli Stäfa, die Zuschauer sassen an ihren Tischen quasi auf der Bühne, von allen Seiten ins turbulente Geschehen mit einbezogen. Ein kluges Konzept, das auch für weitere Gastspiele funktionierte, im Restaurant Safranzunft Basel oder im Solothurner Landhaus, auch wenn die örtlichen Verhältnisse immer ein bisschen anders waren, im Hotel Union in Luzern, im Winterthurer Volkshaus und im Bierhübeli in Bern. Zehn Stationen waren es insgesamt, neun Aufführungen in ausverkauften Sälen, eine Fernsehaufzeichnung und zum Abschluss die Einladung ans Theaterfestival München. Da spielte man in Zelten, in unmittelbarer Nachbarschaft von Pina Bausch und Django Edwards, aus Bremen waren "Die Hungerkünstler" von George Tabori zu Gast, Peter Zadek zeigte einen "Ubu", unvergesslich alles für Jürg Woodtli. Er spielte im "Kochenden Inferno" mit und hatte als Produktionsleiter die ganze Tour organisiert. Aus Deutschland kamen zusätzliche Angebote, man hätte also noch einige Zeit weiterspielen können. Als Amateure aber standen die Mitwirkenden nicht länger zur Verfügung. Daran hätte sich, bei allem Erfolg, so bald nichts geändert, wie sich nachrechnen lässt: ein Budget von 44 000 Franken, praktisch keine Subvention, die Kosten zwar eingespielt, mit einem Überschuss sogar, doch bei über dreissig Beteiligten blieben jeder Person gerade noch 264 Franken.
Also begann man in andere Richtungen weiterzudenken. Das schwerfällige Kollekdoof auf ein professionelles Format reduzieren hiess einer der Lösungsansätze, d.h. auf eine hochqualifizierte Musikertruppe, die mangels schauspielerischen Potenzials mit den Zampanos fusioniert werden könnte. Erste Sondierungsgespräche waren aussichtsreich verlaufen, es gab auch schon weit gediehene Vorarbeiten für ein konkretes Projekt, "Das Liebeskonzil" von Oskar Panizza. Anscheinend aber wollte niemand recht daran glauben, viele waren ausgestiegen, auch Giuseppe Reichmuth, und nicht wiederzugewinnen, als das Kollekdoof mit "Inwieferno" an die früheren Arbeiten anknüpfte. Zu viele neue Leute seien dazugekommen, aufgesprungen auf einen erfolgreichen Zug; es klingt nicht unfreundlich, wenn Reichmuth sie als Trittbrettfahrer bezeichnet.
Was die Professionalisierung angeht, führte "Inwieferno" tatsächlich ein Stück weiter, war verschiedentlich in Deutschland zu Gast auf einer wesentlich längeren Tournee als die beiden vorgängigen Produktionen. "Doch irgendwie", sagt Christoph Baumann, "war für das Kollekdoof die Zeit abgelaufen." Ein viertes Inferno war nicht mehr zu machen und auch kein Schnauf da beim Versuch, sich mit Texten von Stanislaw Lem neu zu orientieren.
So grandios das Kollekdoof an der eigenen Professionalisierung gescheitert sein mag, so hat es doch sehr viel fürs freie Theater bewirkt. Konkret, insistiert Reichmuth, kann Jürg Woodtli sich dieses Verdienst zuschreiben: "Himmel und Hölle hat er in Bewegung gesetzt, um die Kulturverantwortlichen der Zürcher Präsidialabteilung zu einem Augenschein ans Festival nach München zu holen. Und mit den Zelten des Zirkus Atlas aus München hat er kurze Zeit später in Zürich auf der Landiwiese das Theater Spektakel eingeführt."
Vermutlich wurde das Duo GRRH im "Kochenden Inferno" geboren, ohne dass jemand es bemerkt hätte, nicht einmal die beiden Protagonisten, Giuseppe Reichmuth (GR) in der Rolle der Maria Armfeig neben Ruedi Häusermann (RH) auf der kleinen Alternativbühne. Als Kinderstar ist Maria Armfeig eine kleine Diva und vom Wortspiel her das Alter Ego von Giuseppe Reichmuth, der sich nie als Schauspieler verstand. So dauerte es noch ein Weilchen, bis GR bereit war, sich mit RH auf ein, aus seiner Sicht, ihm fremdes Metier einzulassen. Als wüsste er nicht, wie viel sein Humor mit Theater zu tun hat, so sieht es Ruedi Häusermann: "Immer die Frage, was wäre, wenn wir in dieser Situation das und das machen. Um dann auch immer eine Gegensituation einzubauen, etwas ganz Kleines um zukehren, nur ein Wörtchen, vielleicht. Das ist eine Gemeinsamkeit von uns beiden. Ich hatte in Giuseppe einen Verwandten gefunden, obwohl ich das damals noch nicht wusste."
Nichts Grosses sollte es werden und ohne äussere Zwänge entstehen, versicherten sie einander und nahmen sich Zeit. Trafen sich jeden Montag im Trudelhauskeller. Weil dort Ruhetag und der Wirt, Pjotr Frei, ein Freund von ihnen war, hatten sie den ganzen Raum für sich. Meistens aber sassen sie sich an einem Tisch gegenüber oder gingen spazieren, und dabei entwickelten sich ihre Projekte. Mal war es Ruedi Häusermann, der von der Musik her die zündende Idee einbrachte - wie das Piano zu seinen Saiten kam, daraus entstand "Die erste Zeit am Klavier" -, mal waren es die vielseitigen Interessen von Giuseppe Reichmuth. Er redete davon, einen Film zu machen, und hatte ihn schon weitgehend im Kopf: Man sieht zwei Menschen, abwechslungsweise, beide in ihrem Auto. Dann sieht man, dass sie sich einander nähern, auf der Landstrasse bei Othmarsingen auf einem Feld, einem Maisfeld, hoher Mais, es ist Herbst. Merkt dann, dass sie aufeinander zufahren, immer näher, man sieht eine Rauchsäule über dem Maisfeld. Sieht dann, wie die beiden sich auf die Strasse hinaufschleppen, sie helfen einander, legen sich gegenseitig Verbände an, zwei Menschen, die sich vorher nicht kannten. Sie humpeln über die Feldstrasse, ein Autofahrer nimmt sie mit. Und noch während das Publikum im Trudelhauskeller sich diesen Film anschaut, sind die beiden leibhaftig im Saal, mit verbundenen Köpfen, humpeln aufs Podium, um den Hergang zu erläutern, und so nimmt "Eine schöne Bescherung" ihren Lauf.
Schon bei diesem ersten Projekt kamen die unterschiedlichen Arbeitsweisen von GRRH zum Tragen. "Ruedi ist einer, der immer alles sofort ausprobieren muss, auch wenn es nur behelfsmässig ist; ich hingegen neige zur Perfektion, führe lange Listen", sagt Giuseppe Reichmuth. Oder wie Ruedi Häusermann es drastischer ausdrückt: "'So schöne Ideen', dachte ich immer, 'doch warum redet er nur und macht es nicht, der Löli!'" Nicht nur RH wollte vorwärts machen, es war Sommer, bald Ernte auf dem Othmarsinger Feld. Keine Zeit also, ein Drehbuch zu schreiben, RH genügten ein paar Anweisungen, den Part des Gegenfahrers übernahm GR. An der Unfallstelle im Maisfeld wurden beiden Autos die Pneus abmontiert, um den Unfall anzudeuten. Pjotr Frei nahm die beiden verletzten Autostopper ins Trudelhaus mit. Gedreht wurde innert weniger Tage von Sigi Meier, einem Filmschulabsolventen, der ohnehin an einem grösseren Projekt mit Reichmuth interessiert war. Die Kamera, eine Super-8, gehörte Giuseppe; während Jahren hatte er für sich immer wieder damit experimentiert.
"Eine schöne Bescherung" hatte GR aus der Reserve gelockt. Nichts Grosses, nein, etwas anderes war es, was sie beide reizte: von einer Situation, einem Gegenstand aus weiterdenken, daraus etwas machen - und schauen, was passiert. Wie mit den Kinostühlen, die sie von Edi Stöckli geschenkt bekamen. Lange lagen sie auf dem Estrich, ehe GRRH sie an einen Abhang am Goffersberg stellten, vis-à-vis vom Schloss Lenzburg. Es war Sonntagmorgen, zu ein paar Takten Musik öffnete sich ein Theatervorhang über der Wiese, die Zuschauer sassen auf den Kinostühlen und warteten auf die Vorstellung. Die meisten kannten GRRH vom Trudelhauskeller und waren auf alles Mögliche gefasst. Vielleicht hatte Giuseppe sich als Schaf verkleidet. Und war da nicht ein Vogel so verdächtig rasch aus dem Gras aufgeflogen? Flog davon wie ein Vogel, und wieder passierte lange Zeit nichts, bis ein Auto den Goffers berg hinaufgefahren kam. Eine Familie stieg aus, verwundert über die Kinostühle auf der Wiese. Inszeniert wahrscheinlich, das Publikum klatschte, die Familie ging rasch wieder ins Auto zurück. Es waren Sonntagspicknicker, das Wetter prächtig, die Landschaft herausgeputzt, alles so schön. Vom Schloss Lenzburg schauten GRRH unbemerkt mit ihren Feldstechern herüber, und nach einer Stunde etwa, als niemand mehr mit einer Theatervorstellung rechnete, schloss sich der Vorhang, ein kleines Flugzeug knatterte daher, der Pilot warf Zettelchen ins Publikum: "Sie sahen GOFFERSBERG. Danke für Ihren Besuch."
Natürlich kann man solches nur einmal machen. Genauso wie "Eine Reise ins Glück", fünfhundert Personen kamen zum Lenzburger Bahnhof für den Extrazug nach Seon. Während der Fahrt sah man aus dem Fenster den Rolls-Royce, darin Giuseppe und Ruedi, und sah gleichzeitig die beiden als Kondukteure durch den Zug patrouillieren. Keine Wahrnehmungsstörung, nein, es waren Puppen im Auto, von einem Chauffeur gefahren, eine Irritation bleibt trotzdem zurück. Wie all die weiteren Merkwürdigkeiten auf der "Reise ins Glück", unscheinbare Details, fast zu klein, um wahrgenommen zu werden, ein Ständchen der Musikgesellschaft Egliswil in Seon am Bahnhof, Frisurenreklamefotos von Ruedi und Giuseppe im Schaufenster des Coiffeurladens, ihre Stimme aus einem Abwasserschacht, ein kleiner Wasserfall mit jugoslawischem Notengeld oder der Sensemann, der unterwegs die Gruppe ein Stück weit begleitet. Da wird man selber zu einer Attraktion, man stelle sich vor, fünfhundert Personen auf einer gemeinsamen Wanderung von Seon nach Lenzburg. Nachträglich wundert sich Ruedi Häusermann darüber, wie gut die frühen Trudelhausprojekte zu den späteren Arbeiten passen. Und dass sie in Pjotrs Wirtschaft praktisch nie geprobt hatten, auch nicht "Die erste Zeit am Klavier", meistens am Tisch sassen, alles aufschrieben und immer von neuem besprachen: Also, dann sagst du dies, dann sag ich das. Sie hatten keine Ahnung, dass man in einem richtigen Theater probiert. Wussten auch nichts über Minimal Art und Landschaftstheater. Sie machten es einfach.
Auch die Filmarbeit mit Sigi Meier ging weiter. Er hatte "Das kochende Inferno" gesehen und wollte seine Abschlussarbeit an der Filmhochschule München über das Kollekdoof machen. Es lief auf ein Filmporträt von Giuseppe Reichmuth hinaus. Komplizierte technische Konstruktionen wurden verworfen, weil sie mit dem Budget eines Diplomfilms nicht zu realisieren und bald auch nicht mehr nötig waren. Vier Wochen reichten, um ein neues Drehbuch zu schreiben, das meiste war ja schon da: die Badener Altstadt, der Trudelhaus keller, die Weihnachtsparty der Familie Meili in der Claque, das Wandbild im Hallenbad Wettingen, die Jazzer aus dem Kollekdoof, im Atelier "Zürich Eiszeit" und an einer Seitenwand das Zirkusplakat für Pic-o-Pello, die Listen eines Überlebenskünstlers, chronische Geldnöte, platonische Liebschaften, Frauengeschichten, der kleine Brillenträger unter hänselnden Buben in Affoltern am Albis und - als Titelfigur - Maria Armfeig, zum Mann geworden, zu einem alten, blinden Künstler, der sein Leben in Bildern erzählt und ironisch kommentiert, mit brüchiger Stimme. Vieles ist biografisch, einzelne Szenen sind dokumentarisch nachgestellt, andere fiktiv. Nicht immer sind die beiden Ebenen auseinander zu halten, weil im Leben eines Aktionisten sich Kunst und Realität oft durch kreuzen und anderes überraschend hinein funkt. So etwa in der Geschichte vom Künstler, der nicht schmarotzen, sondern dem Staat etwas schenken will. Tatsächlich ist Reichmuth nach Bern gefahren, wie in den Fichen der Bundespolizei festgehalten ist: "Akten (0)902/05, Datum 6. 9.79. v. xxx Notiz betr. R., der am 27. 8.79 dem Gesamt-Bundesrat sein Gemälde 'Bundesräte im Sandkasten' überreichen wollte. Er und seine Kumpane glaubten, dieses unbemerkt ins Parlamentsgebäude deponieren zu können, wobei gleichzeitig die Sicherheitsmassnahmen getestet werden sollten. Das Ganze sollte nur einen 'Gag' sein, und auch gefilmt werden." "Blick" war dabei, mit einem Foto am nächsten Tag, das "Aargauer Volksblatt" berichtete ausführlich. Drei Wochen später schrieb Bundeskanzler Huber nach Oberehrendingen an Giuseppe Reichmuth: "Der Bundesrat hat davon Kenntnis genommen, dass Sie ihm ein Bild, das die sieben Ratsmitglieder darstellt, geschenkweise übermacht haben. Er hat mich beauftragt, Ihnen dafür bestens zu danken. Ihr Werk wird dem für kulturelle Angelegenheiten zuständigen Departement des Innern zur Verwahrung übergeben."
Erfunden dagegen ist die Geschichte vom Künstler, der sein Wandbild im Hallenbad aus der Betonwand heraussprengen will, damit die Wettinger bis nach Rimini und so das wirkliche Meer sehen können. Der Film endet mit einer Explosion. 1980 ist er herausgekommen, in Zürich begannen die Jugendunruhen. "Freie Sicht aufs Mittelmeer" hiess einer der Slogans.
Diese Metapher lag in der Luft. Und das Wandbild ist wie von selber verschwunden. Als das Hallenbad nicht mehr rentierte, wurde es 2001 zur Turnhalle umfunktioniert.
Wenn es um die Liebe geht, gibt Maria Armfeig sich abgeklärt. Macht gerne Andeutungen und trifft sich hin und wieder mit Rosa zu einem guten Essen in stilvollen Restaurants. Ein trautes Paar, das die Stürme des Lebens hinter sich hat. Lassen wir's dabei bewenden, viel mehr würde Giuseppe Reichmuth zu diesem Thema nicht sagen: dass er verheiratet war, in zweiter Ehe mit der Musikerin Petja Kaufmann an der Englischviertelstrasse in Zürich, und dass sie inzwischen geschieden sind, in Freundschaft.
"Maria Armfeig", zu einem Spielfilm ausgewachsen, wurde zu Sigi Meiers Abschlussarbeit im wörtlichen Sinn. Er schrieb später Drehbücher und wechselte dann ins Ausstellungsfach, zur international tätigen Bellprat Associates, die sich auf dreidimensional inszenierte Erlebniswelten für die Auftritte von Grossunternehmen spezialisiert hat. Umso überraschender für Giuseppe, dass Sigi ihn nach zwanzig Jahren noch einmal um Mitarbeit bat. Es ging um den Auftrag eines Westschweizer Stromkonzerns, der möglichst originell an der Expo.02 auftreten wollte. Eine erste Idee war vorhanden, man wollte einen der Pavillons auf der Arteplage in Neuchâtel zum Lampenladen ausstaffieren. Stattdessen baute Giuseppe Reichmuth sein elektrisches Haushaltgeräteorchester. "Ursprünglich dachte ich, man könnte Musik machen mit verschiedenen Staubsaugern zum Beispiel, aber das ist gar nicht so einfach. Dass du dies als Ton wahrnimmst, als Melodie, das geht kaum. Du nimmst das als Geräusch wahr. Wenn du eine Melodie spielen möchtest, musst du immer denselben Motor nehmen. Deshalb kam ich auf den Fön. Mit andern Maschinen bringst du keine Oktave zustande, da haben wir ein bisschen gemogelt. Wir haben Flaschen genommen, sie unterschiedlich mit Sand gefüllt und mit dem Fön darauf geblasen. So brachten wir mehr als eine Oktave zustande. Und die Staubsaugerschläuche begannen sich zu bewegen. Wir machten eine Kombination, Geräusche mit verschiedenen Haushaltmaschinen, dann kam die Melodie, die Nationalhymne." Geholfen dabei haben ihm Ruedi Häusermann und der Musiker Philipp Läng.
Selbstverständlich wäre Giuseppe Reichmuth zu weiteren Filmen bereit gewesen, wenn sich eine Gelegenheit ergeben hätte. So blieb es bei einer Nebenrolle von GRRH in "Akropolis Now" und einem Pilotversuch des Schweizer Fernsehens. In der Sondersendung über die eidgenössischen Wahlen 1983 waren die beiden, als Pausenclowns gewissermassen, mit Emil Steinberger, Peter Hürzeler und Ueli Zindel im Einsatz. Die Weiterführung zu einem eigenen Sendegefäss, wie der Unterhaltungsverantwortliche des Schweizer Fernsehens dies wünschte, scheiterte an unterschiedlichen Vorstellungen über Satire.
Anfang der Achtzigerjahre war Giuseppe Reichmuth nach Zürich gezogen. Hier ergaben sich für GRRH auch Möglichkeiten, ihre Arbeiten in grösserem Rahmen zu zeigen. Auch wenn es pro Vorstellung jeweils nur sieben Personen waren, die 1982 am Theater Spektakel "Zu Besuch im Wohnwagen" empfangen werden konnten - wieder eine von Giuseppes Gegensituationen: Während draussen das Festival immer grössere Dimensionen annahm, erlebten die Besucher im Wohnwagen am eigenen Leib, wie unbehaglich die Aufforderung sein kann, sich wie zu Hause zu fühlen.
Im folgenden Jahr trugen GRRH sich mit der Idee, eine Kirche auf die Landiwiese zu bauen, als Ort der Besinnung mitten im Rummel eines Events, glücklicherweise liessen sie es bleiben, es hätte nicht zu ihnen gepasst, so dick aufzutragen.
Den Wohnwagen hatten sie ein paar Jahre früher gekauft und ohnehin an einer Idee über seine Verwendung gebrütet. Umso besser, dass er nun so gut zum Theater Spektakel passte. Ähnlich erging es GRRH, als sie 1985 um einen Beitrag für das Minimal Festival gebeten wurden. Seit längerem schon hatten sie versucht, Originaluniformen der Zürcher Stadtpolizei aufzutreiben. Wie ihnen das gelang, verraten sie nicht, jedenfalls fanden sich die Uniformen, und das war das Wichtigste: dass GRRH wie Polizisten aussahen bei ihren Patrouillen im Niederdorf und für die Passanten nur ein paar Details nicht recht stimmen wollten. Zwei Polizisten, die Hand in Hand in der Stadt unterwegs waren, alten Frauen über die Strasse halfen und potenzielle Strafsünder höflich über die geltende Rechtsordnung aufklärten, Bussenlisten bei sich hatten und sie im Volk verteilten, 161 Bestimmungen insgesamt, alles authentisch: 10 Franken für Fahren ohne Glocke oder ohne Diebstahlsicherung (BAV 74 VI), 20 Franken für verbotenes Nachzahlen oder Zahlen nach abgelaufener Parkzeit (SSV 48), 30 Franken für Verwenden von Spikereifen ausserhalb der Zeit, während der sie gestattet sind (Art 1. der Verordnung vom 29. 9. 1975). Freundliche Ordnungshüter, wie es sein müsste im Grunde. In Zürich war "Bleu et gentil" eine Provokation nach den brutalen Polizeieinsätzen während der Jugendunruhen. "Und in Deutschland", sagt Giuseppe Reichmuth, "wurde unser Auftritt auf der Quaibrücke von einer Werbefirma abgekupfert." Springer & Jacobi adaptierte das schöne Bild von den Trottinett fahrenden Polizisten für eine Inseratenkampagne im "Spiegel" und wäre wohl noch weitergegangen, wenn GRRH nicht einen Anwalt eingeschaltet hätten.
Die Projekte der Achtzigerjahre entwickelten GRRH abwechslungsweise in Zürich und im Aargau. Programmatische Absicht war das nicht und wohl auch ein schöner Zufall wieder, dass Giuseppe Reichmuth kurz nach "Bleu et gentil" an zwei Ausstellungen beteiligt war. Für "Kunst am Hut" im Strauhof machte er eine Installation in einem dunklen Zimmerchen - "auch unsere Polizistenhüte waren da vertreten" -, Tür an Tür mit Kollegen wie Daniel Spoerry, Dieter Roth und HR Giger. Beim Beitrag zur Freilichtausstellung rund ums Schloss Lenzburg hatte Ruedi Häusermann ein bisschen nachgeholfen. "Die Kuratorin Elisabeth Staffelbach bat mich, an der Vernissage Saxophon zu spielen. Sie hatte gute Künstler eingeladen, Roman Signer und Heidi Bucher und Mario Merz zum Beispiel, und da sagte ich, halb zum Spass, dass ich schon spielen, aber auch selber etwas zeigen wolle. Sie war zuerst erschrocken, dann aber einverstanden, und ich habe sofort Giuseppe angerufen." Zusammen bauten sie eine Mikrowelt und eine Makrowelt. Die Mikrowelt existierte bereits; an der Schlossmauer in Lenzburg gibt es, auch auf dem neuen Verputz, seit alters eine Ameisenstrasse, in unglaublichem Tempo rasen die Ameisen über all die Schrunden hinauf und hinunter. Und es brauchte nur ein paar feine Eingriffe, um sichtbar zu machen, dass es sich um eine Autostrasse handelt, die Ameisenautobergstrasse. Mit feinem Pinsel malten GRRH eine Strasse mit weissen Mittelstreifen; und wo die Ameisen im Fels verschwinden, modellierten sie das Ameisen berg dorf, samt einem Campanile, und hinter der kleinen Kirche war ein ganz kleiner Laut sprecher montiert. Daraus läuteten leise die Glocken einer Tessiner Kirche. So leise, als kämen sie von der andern Seite des Tals. Wenn die Ausstellungsbesucher laut waren, konnten sie die Glocken nicht hören und gingen achtlos an der Mauer vorbei. Dazu die Makrowelt, wieder eine Strasse, dieselbe Strasse, sie aber führt in den Himmel. Es ist die Milchstrasse, wie Ruedi Häusermann erklärt: "Dazu habe ich die Musik gemacht, Vernissagenmusik auf dem Saxophon, und damit die Kühe herbeigetrieben zu einem Heuhaufen, und darin sass Giuseppe und fädelte weisses Styropor auf einen Silkfaden. Diesen hatten wir zuvor bis zum nächsten Hügel gespannt - durch alle Bäume hindurch, das war eine Riesenarbeit -, und jetzt frassen die Kühe vom Heuhaufen, und aus dem wuchs langsam, langsam, ein weisser Mittelstreifen in den Himmel, die Milchstrasse. Hörte nicht mehr auf, und ich spielte Saxophon, dazu die Glocken der Kühe. Es war grossartig. Perfekt!"
Ein bewegtes Jahr, verschiedenste Arbeiten, dazu die Diskussionen über Humor im Fernsehen, das alles war zu viel. Ende 1985 beschloss Giuseppe Reichmuth, für unbestimmte Zeit die Schweiz zu verlassen. Den ersten Winter verbrachte er auf Sardinien, dann anderthalb Jahre in Genua in der Wohnung von Bernd Höppner, einem befreundeten Künstler. Seit seinem Pariser Jahr war er nie mehr länger im Ausland gewesen, es trieb ihn in die Grossstadt, erfuhr nach New York, jeweils für zwölf Monate, 1987/88 am Prospect Place, 1994 in einem Loft an der Water street in Brooklyn. Dazwischen lebte er im Tessin, fürs Erste bei seiner Schwester Barbara und ihrem Mann Pjotr Frei. Auf einer Wanderung lernte er ein Journalistenehepaar aus Curio kennen, Besitzer einer alten Villa, und richtete in ihrem Dach stock sein Atelier ein - Tür zu! Ruhe und Zeit wieder zum Malen.
Mit dem Theater hatte er während dieses zehnjährigen Lebensabschnitts nichts zu schaffen. Oder nur indirekt, weil Ruedi Häusermann seine Hilfe brauchte. Er war als Theatermusiker unterdessen zur Family von Christoph Marthaler gestossen, involviert bis zu "Murks den Europäer", und wollte sich nun ein Jahr freihalten, um sein erstes Soloprogramm zu entwickeln. Immer wieder reiste er mit Entwürfen für ein paar Tage nach Curio und fand in Giuseppe einen kritischen Partner. In diesem Sinn ist "Der Schritt ins Jenseits" als Gemeinschaftswerk zu verstehen.
Giuseppe Reichmuth wäre wohl noch einige Zeit länger in New York geblieben, hätte Ruedi Häusermann ihm nicht Ende 1994 ein Flugticket geschickt, mit der Bitte, für ein gemeinsames Theaterprojekt nach Berlin zu kommen. Die Volksbühne hatte als zusätzliche Spielstätte den "Prater" erhalten. Zu DDR-Zeiten war dies ein Lokal für politische und kulturelle Veranstaltungen gewesen, hier trafen sich auch Vereine, im Sommer gab es Konzerte auf der kleinen Gartenbühne, und noch 1995 waren die Renovationsarbeiten nicht abgeschlossen, weil es an Geld fehlte. Genau diese Umbruchsituation empfanden GRRH als eine reizvolle Herausforderung. Sie eröffneten die Wiederbelebung des Pratergartens mit einem Gospelchor, der bekannte Schauspieler Klaus Mertens gab den Conferencier und überliess die Bühne dann Peter Wawerzinek, einem Schriftsteller, der jahrelang im Untergrund gelebt hatte und auch nach der Wende ein Geheimtipp blieb. Seine Lesung aus dem Roman "Moppel Schappiks Tätowierungen" wurde mit zwanzig Lautsprecherchen auf das ganze Areal übertragen, von den Bäumen, ja sogar aus dem Abwasserschacht war seine Stimme zu hören, während das Publikum den Garten erkundete und das kleine Museum, wo Giuseppe Reichmuth eine Sammlung mit kleinen Alltagsgegenständen installiert hatte, Strandgut aus der DDR: "Etwas vom Schönsten waren die Zigarettenstummel, fünf Gestelle voller Stummel, ich habe sie alle nummeriert. Die Bühnenbildassistentin war zuerst gar nicht begeistert von dieser Arbeit, danach aber sagte sie, es habe sich gelohnt. Das sah so schön aus, richtig wertvoll."
Seither lebt Giuseppe Reichmuth wieder in Zürich, in seiner Atelierwohnung im Volks haus. Zu einem Bühnenbildner, wie Ruedi Häusermann ihn sich wünschte, ist er nicht geworden. Oder nur punktuell, die Zusammenarbeit in "Trübe Quellenlage" für das Basler Theater verdeutlichte beiden, wie weit "Der Schritt ins Jenseits" sie auseinander geführt hatte. Häusermann ist als Regisseur eigener Projekte in seinen Beruf hineingewachsen, in immer grössere Theaterbetriebe mit komplexen Arbeitsteilungen und strikten Terminplänen. Reichmuth ist und bleibt ein freier Künstler. Umso mehr verbindet beide das Genre übergreifende.
Einen Moment lang war es, als käme ein Panzer auf einen zugefahren, beim nächtlichen "Auf-Gang" am Festival Rümlingen. Es war Giuseppe, der mit zwei Taschenlampen daherspazierte. Die Geräusche aus dem Ghettoblaster auf seiner Brust stammten von einem Traktor. Als Künstler zum Performer geworden, ein musikalischer Mensch, und vielleicht macht er ihn noch, mit seinen zweiundsechzig Jahren: den Schnägglifilm. Ausschliessen will Giuseppe Reichmuth es nicht.
zurück